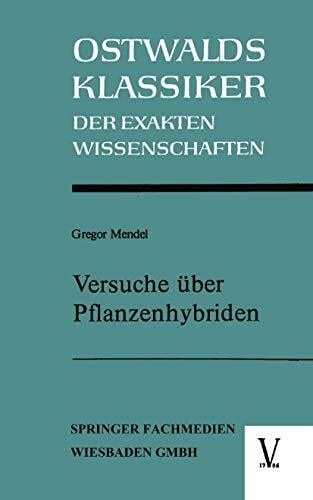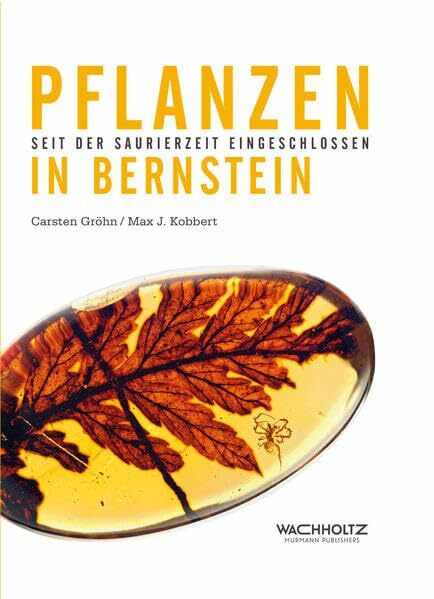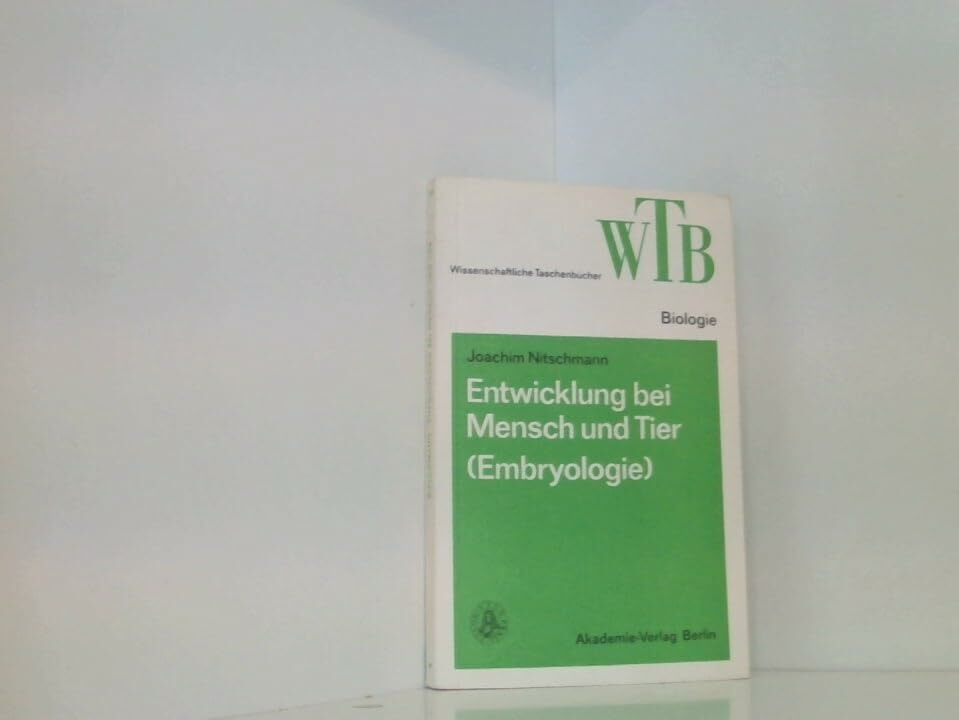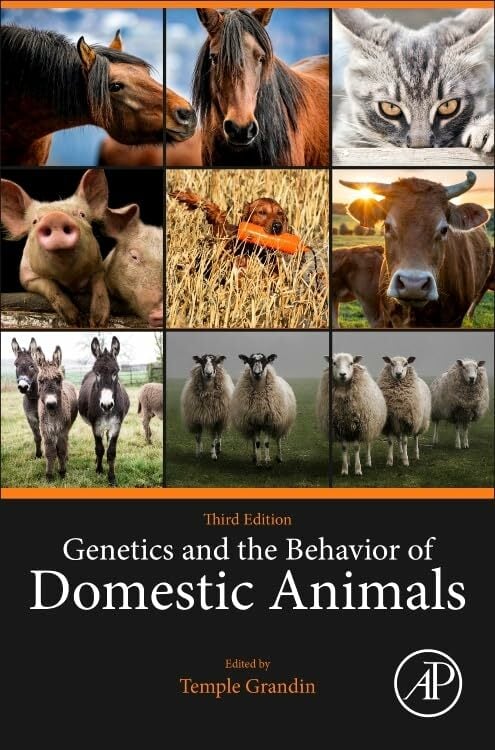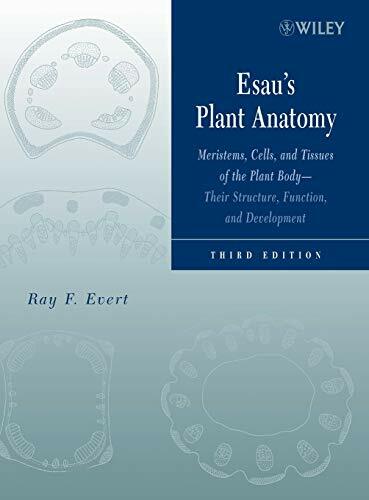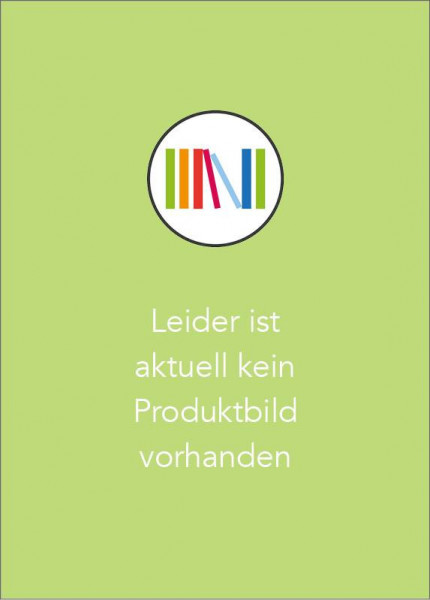
Ideengeschichte zur Vererbung bei Kulturpflanzen und Haustieren
Kurzinformation
inkl. MwSt. Versandinformationen
Artikel zZt. nicht lieferbar
Artikel zZt. nicht lieferbar

Beschreibung
Dass Kinder ihren Eltern ähnlich sind, haben die Menschen schon früh erkannt. Warum das so ist, wussten sie nicht. Erst die Entstehung der Wissenschaften seit der frühen Neuzeit schuf die Voraussetzungen, um diese Frage zu beantworten. Zu einer exakten, d. h. mittels wiederholbaren Experimenten und damit überprüfbaren Ergebnissen arbeitenden Wissenschaft wurde die Vererbungslehre aber erst seit 1856 mit dem Beginn der Experimente Johann Gregor Mendels und erst 1906 erhielt sie die Bezeichnung "Genetik". Der Autor, u. a. bereits durch mehrere Veröffentlichungen zur Agrargeschichte und Geschichte der Agrarwissenschaften bekannt, spürt unter Auswertung von über 1000 Publikationen der Frage nach, welche Ideen zur Vererbung bei Kulturpflanzen und Haustieren seit dem Altertum vertreten, welche Schlussfolgerungen daraus für die Züchtung abgeleitet worden sind und zu welchen Auseinandersetzungen es zwischen den Vertretern verschiedener Richtungen kam. Er geht in diesem Zusammenhang auch der Frage nach, welche Einflüsse von Ideen der Naturforscher zur Vererbung auf die Pflanzen- und Tierzüchter, aber auch umgekehrt existierten. Der Verfasser belegt dabei seine Erkenntnisse mit einer Vielzahl von Zitaten. Während für die Biologen vor allem die Arten und ihre Abgrenzung untereinander, d. h. der Artbegriff, im Mittelpunkt der Forschung standen, kam es den Landwirten und Gärtnern auf die "Abarten" an, d. h. diejenigen Varietäten einer Art, die besondere Eigenschaften wie z. B. hohe Ertragsfähigkeit und Krankheitsresistenz besaßen. Unabhängig von den Biologen erkannten führende Landwirte und Gärtner bereits vor Mendel, dass bei Kreuzung Uniformität oder Dominanz und in der 2. Filialgeneration Aufspaltungen auftreten können. Dazu zählt auch der Begründer der Landwirtschaftswissenschaft in Deutschland, Albrecht Daniel Thaer, der zugleich auch Gedanken über Variabilität und Auslese äußerte und damit nicht nur ein Vorläufer Mendels, sondern auch Darwins ist. Zur Entdeckung der nach ihm benannten Regeln dürfte wesentlich beigetragen haben, dass Mendel aus einer Bauernwirtschaft stammte, neben Theologie auch Landwirtschaft studierte und damit das Denken der Landwirte kannte. Das trifft auch auf zwei der drei Wiederentdecker der Mendelschen Regeln zu, Hugo de Vries war an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin tätig, Erich von Tschermak-Seyssenegg Pflanzenzüchter. Während in der Pflanzenzucht in Deutschland im Allgemeinen die neuen Erkenntnisse der Genetik relativ schnell genutzt wurden, wobei sich vor allem Erwin Baur und Theodor Roemer wesentliche Verdienste erwarben, blieb die Tierzucht dabei zurück. Dafür gab es sowohl objektive als auch subjektive Gründe. Zu den ersteren zählten die geringe Zahl der Nachkommen bei Haustieren, deren hoher Preis und die Schwierigkeit, die Wirkung einzelner Faktoren zu analysieren. Allerdings unterschätzten Tierzüchter auch die Bedeutung der Mendelschen Regeln und weiterer neuer Erkenntnisse u. a. deshalb, weil sie unter Haeckels Einfluss Anhänger der progressiven Vererbung, d. h. der Vererbung erworbener Eigenschaften, waren. Größere Fortschritte erbrachten erst die Arbeiten ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, vor allem unter Leitung von Carl Kronacher. Die Isolierung und Zerstörung im Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass Deutschland gegenüber dem Ausland bei einer der bedeutendsten Entwicklung, der Herausbildung der Populationsgenetik, zurückblieb, so dass nach dem Krieg auf diesem Gebiet wesentliche Anstrengungen unternommen werden mussten. Das Buch enthält eine Vielzahl überraschender Erkenntnisse. Z. B. entdeckte der Gärtner Grotjan bereits im 18. Jahrhundert Mutationen, die sich unmittelbar vererben und zu neuen Sorten führen. In Bezug auf die Konstanztheorie übernahmen renommierte Wissenschaftler fehlerhafte Beschreibungen des Inhalts von Publikationen durch andere, ohne die Originalquellen zu studieren, was auch zu Fehleinschätzungen führte.
Produktdetails

So garantieren wir Dir zu jeder Zeit Premiumqualität.
Über den Autor
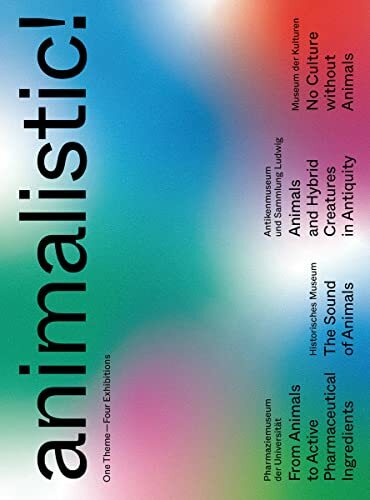
- Kartoniert
- 187 Seiten
- Erschienen 2021
- Hatje Cantz Verlag

- hardcover
- 491 Seiten
- Erschienen 2012
- Wilhelm Fink

- Gebunden
- 354 Seiten
- Erschienen 2022
- De Gruyter Oldenbourg

- Gebunden
- 608 Seiten
- Erschienen 2018
- Anaconda Verlag